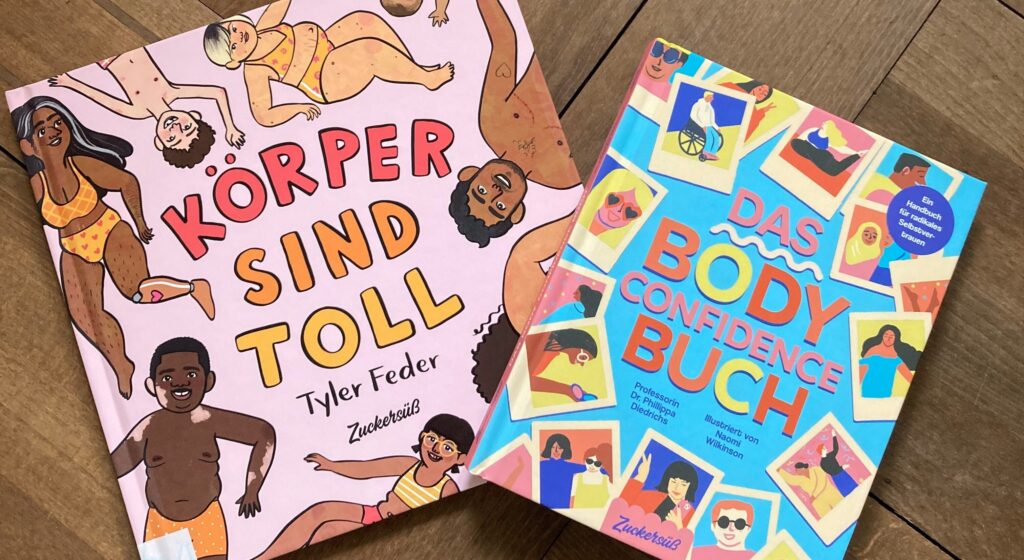Filmempfehlung: NZZ Format «Angst auf der Strasse – wie männliche Gewalt das Leben von Frauen prägt»
10. Juli 2025
Die kürzlich veröffentlichte Reportage von NZZ Format «Angst auf der Strasse – wie männliche Gewalt das Leben von Frauen prägt» setzt sich damit auseinander, wie der öffentliche Raum sicherer werden kann und macht deutlich, dass Prävention nur gelingt, wenn Männer Verantwortung übernehmen, Victim Blaming erkannt wird und Zivilcourage gestärkt wird.
Die Prävention von sexualisierter Gewalt hat sich über Jahrzehnte hinweg fast ausschliesslich auf potenzielle Opfer konzentriert. Im Zentrum stand die Frage: Wie verhalten sich Frauen und wie sollten sie sich verhalten, um Übergriffe zu vermeiden? Ihnen wird geraten, stets auf ihr Getränk zu achten, nicht zu viel zu trinken, bestimmte Kleidungsstücke zu meiden oder den eigenen Standort mit Vertrauenspersonen zu teilen. Doch solche Ratschläge beinhalten eine Form von Täter-Opfer-Umkehr. Wenn einer Frau vermittelt wird, sie solle bestimmte Kleidung meiden, um nicht belästigt zu werden, dann schwingt dabei immer die Implikation mit: Wer sich nicht an diese „Regeln“ hält, trägt eine Mitschuld an einem Übergriff.
So wird die Verantwortung von den Tatpersonen weg und auf die Frauen gelenkt. Statt den Fokus darauf zu legen, wie übergriffiges Verhalten verhindert werden kann, wird überlegt, wie Frauen sich anpassen müssen, um es zu vermeiden. Was oft als Prävention verpackt wird, ist laut Agota Lavoyer in Wahrheit Victim Blaming. Denn sexualisierte Gewalt können nur diejenigen verhindern, die sie ausüben. Nicht die Opfer.
Ein Beispiel für einen konkreten Ansatz zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum, zeigt das Projekt „Luzern schaut hin“. Hier wurde ein Onlinemeldetool eingeführt, über das sexistische oder queerfeindliche Belästigungen im öffentlichen Raum anonym gemeldet werden können. Aus den gesammelten Daten werden gezielt Massnahmen abgeleitet, etwa zur Stärkung von Zivilcourage. Denn viele Betroffene berichten, dass sie an Orten mit vielen Menschen belästigt wurden, jedoch niemand etwas gesagt oder geholfen hat. Dieses Schweigen der Gesellschaft kann für Opfer belastend sein. Zur eigentlichen Belästigung kommt das Gefühl, allein gelassen zu werden. Es können Unsicherheit und Zweifel an der eigenen Wahrnehmung entstehen und für den Täter die Bestätigung, dass sein Verhalten toleriert wird.
Zivilcourage kann hier viel bewirken: Wer eingreift, unterstützt nicht nur Betroffene, sondern sendet auch ein deutliches Signal an Täter, dass Belästigung nicht in Ordnung ist. Auf der Webseite von Luzern schaut hin, finden sich Informationen, wie sich Menschen die Belästigung beobachten verhalten können. Zudem werden von Amnesty International immer wieder Kurse zur Zivilcourage angeboten.